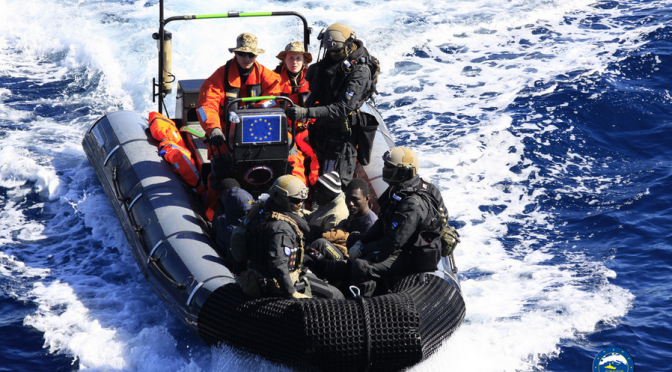In der Forschungsförderung unterstützen Europäische Union und deutsche Bundesregierung die Abwehr unerwünschter Einwanderung: Die Entdeckung von unerlaubt Einreisenden oder Eingereisten soll verbessert, Grenzen sollen effektiver überwacht und Netzwerke der Grenzsicherungsbehörden sollen gestärkt werden. Die Forschungen legitimieren sich mit Lücken im Grenzschutz, deren Existenz sie zugleich aufdecken und schließen wollen. Sie versprechen, soziale Probleme mit den Mitteln fortgeschrittener Informations- und Naturwissenschaft zu lösen – mit negativen Wirkungen weit jenseits der Migrationsabwehr.
Öffentlich wenig bekannt ist, woran die Unternehmen der Informations-, Kommunikations- und Überwachungstechnologien in ihren Laboratorien und Forschungsabteilungen gegenwärtig arbeiten. Erkennbar ist nur jener Ausschnitt an Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten, die über staatliche Förderprogramme unterstützt werden. Der Blick auf diesen Ausschnitt erlaubt zwei Hinweise: Erstens kann er anzeigen, mit welchen Verfahren, welche Teilziele zur Umsetzung der politisch gewünschten Migrationsabwehr verfolgt werden sollen. Weil es hier um Forschungsvorhaben geht, handelt es sich regelmäßig um vollmundige Versprechen über die praktische Nützlichkeit des durch die Forschung Entwickelten; insofern ist deren tatsächliche Wirkung für die Zukunft ungewiss. Zweitens erlaubt die Forschungsförderung einen Blick auf den Zustand der Migrationsabwehr: Denn die Projekte verdanken ihre Förderung dem Umstand, dass sie in ihren Anträgen erfolgreich bestehende Überwachungs- und Kontrolldefizite behaupten, die sie zu schließen versprechen. Da die Abwehr unerwünschter Migration seit Jahrzehnten zum Kern europäischer Grenzpolitik gehört, wird in den Forschungsprojekten zugleich deutlich, welchen Umfang und welche Eingriffstiefe das Grenzkontrollparadigma mittlerweile erreicht hat. Den Fortschritt nutzen: Migrationsabwehr als angewandte Wissenschaft weiterlesen