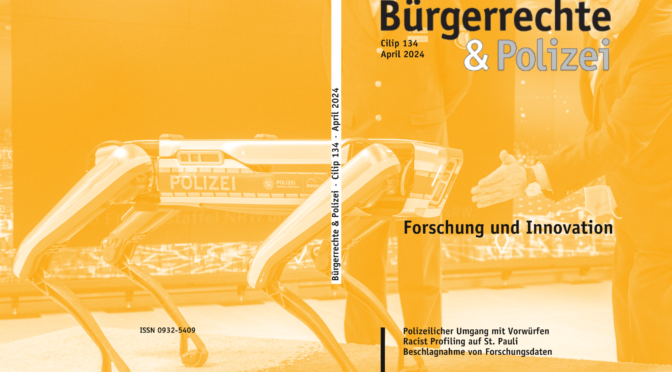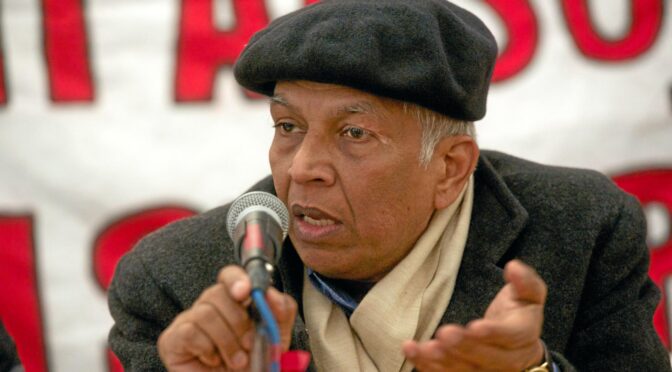von Jens Hälterlein
Der polizeiliche Einsatz von biometrischer Gesichtserkennung (BG) ist eine der umstrittensten Anwendungen Künstlicher Intelligenz (KI). Im Kern geht es darum, ob dem Sicherheitsversprechen der Technologie oder der von ihr ausgehenden Gefahr der Einschränkung von Grund- und Bürgerrechten eine größere Bedeutung beigemessen wird. Die Annahme einer hohen Leistungsfähigkeit der eingesetzten Systeme muss relativiert werden – und damit auch das Sicherheitsversprechen. Zudem hat der Einsatz von BG diskriminierende Effekte.
Nachdem die Europäische Kommission 2021 einen ersten Vorschlag für eine Regulierung von KI-Anwendung auf EU-Ebene vorgelegt hatte (Artificial Intelligence Act),[1] kam es im Zuge des Gesetzgebungsverfahren zu einer intensiven Kontroverse. Im Sommer 2023 machte das Europäische Parlament umfangreiche Änderungsvorschläge, um den Grundrechteschutz zu stärken. Bestimmte KI-Praktiken sollten grundsätzlich verboten werden, da sie nicht mit den in der EU geltenden Grundrechten und Werten vereinbar wären. Zu den genannten Praktiken gehört auch die biometrischer Gesichtserkennung (BG) in öffentlichen Räumen (Art. 5). Dies entsprach der Forderung eines Bündnisses von zivilgesellschaftlichen Initiativen sowie einer Viertelmillion EU-Bürger*innen, die ihre Unterstützung der von mehr als 80 NGOs organisierten Kampagne Ban Biometric Mass Surveillance in Europe geäußert hatten. In der (vorläufigen) Kompromissfassung vom Dezember 2023, auf die sich das Europäische Parlament, der Rat der Europäischen Union und die Europäische Kommission einigten, werden jedoch Ausnahmen von einem allgemeinen Verbot der Massenüberwachung definiert, bei denen Sicherheitsinteressen die Risiken der Technologie für Grundrechte überwiegen würden: wenn der Einsatz von BG zur Echtzeit-Überwachung verwendet wird, um terroristischen Anschläge zu verhindern oder nach vermissten Personen zu suchen, aber auch, wenn BG eingesetzt werden soll, um im Rahmen von Strafverfahren Tatverdächtige zu ermitteln.[2] Biometrische Gesichtserkennung – Technologischer Solutionismus für mehr „Sicherheit“ weiterlesen