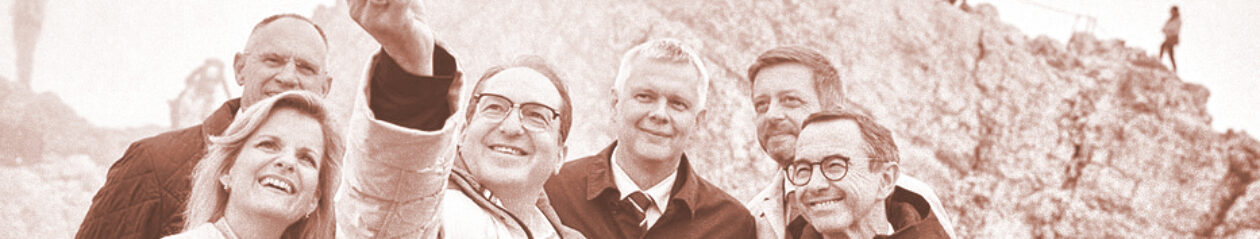von Norbert Pütter
Während „Community Policing“ in Deutschland erst in den letzten Jahren „entdeckt“ wurde, besteht in den angelsächsischen Ländern eine lange Tradition lokaler, gemeindebezogener Polizeiarbeit. Und während in der deutschen Diskussion die wohlklingende Rhetorik einer „bürgerorientierten“ oder „gemeinwesenorientierten“ Polizeiarbeit im Vordergrund steht, verweisen die ausländischen Erfahrungen stärker auf die Voraussetzungen, Widersprüche und Ambivalenzen, die mit einer solchen Strategie verbunden sind. „Community Policing“ schafft neue Probleme im Hinblick auf die gesellschaftliche Rolle der Polizei – ohne die alten zu lösen.
„Community Policing“ (CP) ist weder ein einheitliches Konzept, noch steht es für eine genau bestimmbare Form polizeilicher Arbeit. Auch die Begriffe variieren: „Community Policing“, „Neighborhood Policing“, „Community-oriented Policing“, „Problem-oriented Policing“ etc. Insgesamt handelt es sich um ein nicht genau abgrenzbares Konzept, das eine „Bewegung“ oder ein relativ vages polizeiliches Selbstverständnis bezeichnet. Empirisch ist die Spannweite erheblich. Sie reicht von der bloßen Behauptung von Polizeibehörden, die eigene Arbeit sei CP, bis hin zu Versuchen, die Organisation der Polizei, ihre Aufgaben und Einsatzformen auf eine neue Basis zu stellen. Jenseits aller Unterschiede lassen sich zwei Gemeinsamkeiten ausmachen, denen sich alle Varianten von CP verpflichtet fühlen: Sie betonen, wie wichtig eine enge(re) Zusammenarbeit von Polizei und Gemeinde ist, und sie wollen die Arbeit darauf ausrichten, Probleme im lokalen Kontext zu lösen. Exemplarisch kommen beide Aspekte in der folgenden Definition zum Ausdruck: „Community policing ist eine neue Philosophie der Polizeiarbeit, die auf dem Konzept basiert, daß kreative Formen des Zusammenwirkens von PolizistInnen mit BürgerInnen dazu beitragen können, gegenwärtige Probleme in Gemeinden zu lösen, die mit Kriminalität, Kriminalitätsfurcht, sozialer oder physischer Unordnung und dem Verfall von Nachbarschaften zusammenhängen.“[1] „Community Policing“ – Alternative zu herkömmlicher Polizeiarbeit? weiterlesen