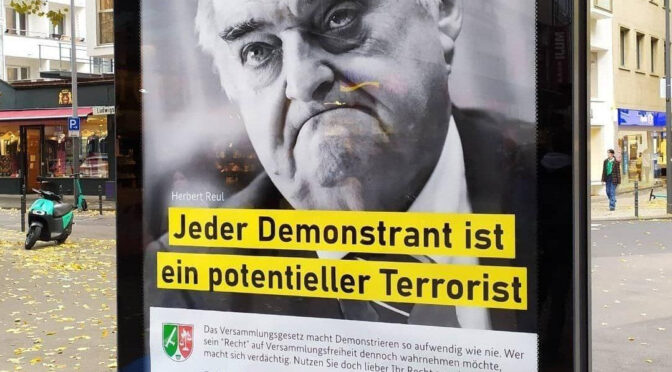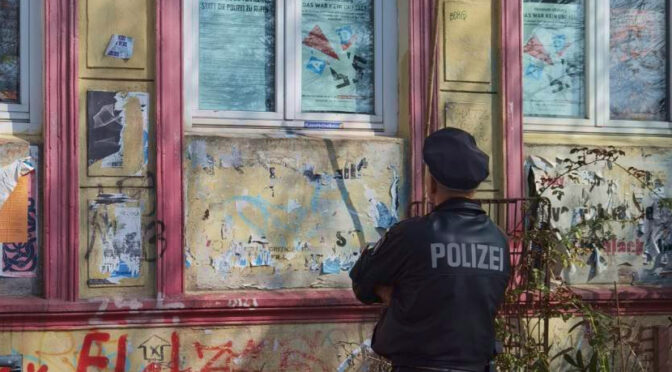zusammengestellt von Otto Diederichs
1. Januar: Rechtsextremismus: In Iserlohn (NRW) werden auf einem muslimischen Friedhof 30 Grabstellen verwüstet. Durch eine parlamentarische Anfrage der Linksfraktion im Berliner Abgeordnetenhaus wird am 6. Januar bekannt, dass in einem Berliner Bezirk zwischen März und Dezember 2021 insgesamt 123 rechtsextremistische Straftaten registriert wurden (Juni 2020 – März 2021: 155). Durch Presseberichte wird am 14. Januar bekannt, dass die StA Marburg (Hessen) drei Burschenschafter der Studentenvereinigung „Frankonia“ wegen gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung anklagt. Die Männer hatten im Juni 2020 das Verbindungshaus der Vereinigung überfallen. Hintergrund ist eine Auseinandersetzung zwischen rechten und liberal gesinnten Studenten. Am 15. Januar entdecken Polizist*innen in Berlin einen Mann, der auf einen Baukran geklettert ist. Als sie ihn auffordern herunter zu kommen, zeigt er den Hitlergruß und grölt nationalsozialistische Parolen. Er wird festgenommen. Am 18. Januar wird durch eine parlamentarische Anfrage der AfD-Fraktion im Bundestag bekannt, dass die Statistik des Bundeskriminalamtes (BKA) 2021 insgesamt 19.000 rechtsextreme Straftaten verzeichnet. Auf Pressenachfragen bestätigt die Generalbundesanwaltschaft (GBA) am 21. Januar, dass sie das Ermittlungsverfahren gegen zwei Mitglieder der rechtsextremistischen „Prepper“-Gruppe „Nordkreuz“ wegen Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat nach über vier Jahren aus nicht hinreichendem Tatverdacht eingestellt hat. Am gleichen Tag wird ebenfalls durch Presserecherchen bekannt, dass der seit Dezember 2020 amtierende Chef der Bundestags-Polizei Mitglied der rechten Burschenschaft „Gothia“ ist. Die Burschenschaft hat personelle Verbindungen zur rechtsextremen „Identitären Bewegung“ und der AfD. Der Referatsleiter wurde bis auf Weiteres von seinen Aufgaben entbunden. In Halle (Sachsen-Anhalt) gibt am 23. Januar ein Mann aus einem gegenüberliegenden Haus mehrere Schüsse mit einer Luftdruckwaffe auf eine Moschee ab. Er wird festgenommen; laut Polizei war er bisher nicht auffällig. Am 24. Januar spricht das Justizministerium Sachsen-Anhalt einer Auszubildenden im Justizvollzugsdienst wegen Rechtsextremismusverdacht ein Betretungsverbot für Haftanstalten aus. Eine weitere dienstliche Prüfung ist eingeleitet. Am 29. Januar durchsucht die Polizei in Fulda (Hessen) nach einem Hinweis ein Mehrfamilienhaus. Dabei werden Nazi-Devotionalien, Waffen und Munition gefunden und sichergestellt. Chronologie Januar 2022 weiterlesen