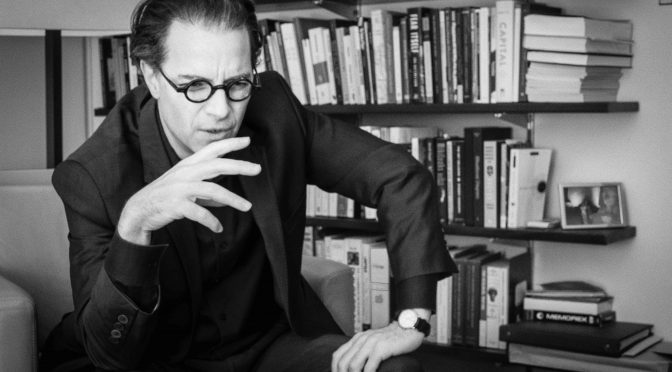Kapitalismus war lange Zeit out. Seit Finanzkrise und Pandemie widmen sich soziale Bewegungen mit unterschiedlichen Verhältnissen zum repressiven Staatsapparat sowie die Kritische Kriminologie, in der abolitionistische Traditionen aufleben, verstärkt der kapitalistischen Vergesellschaftung. Der Beitrag umreißt, welche Fragen gestellt und künftig bearbeitet werden sollten.
Kontrolle im Kapitalismus zu betrachten, ist seit jeher das Metier der marxistisch inspirierten Kritischen Kriminologie. Schon die sogenannten „Neuen Sozialen Bewegungen“ und parallele Theorieentwicklungen seit den späten 1960er Jahren rückten bekanntermaßen Herrschaftsverhältnisse jenseits des Widerspruchs von Kapital und Arbeit verstärkt in den Blick. In Fortentwicklung und zugleich Kritik der Kritischen Kriminologie entstand etwa eine feministische Kriminologie, die Themen wie Abtreibung, Sexarbeit oder Vergewaltigung in den Blick nahm. Seit den 1990er Jahren sorgte die Verbreitung poststrukturalistischer Ansätze in der Wissenschaft und den sozialen Bewegungen für einen Perspektivwechsel. Kriminolog*innen und Aktivist*innen problematisierten nicht mehr „nur“ materielle Gegebenheiten wie die kapitalismusstabilisierende Wirkung des Strafjustizsystems, die ideologischen Hintergründe und materiellen Effekte einer geschlechtsblinden Klassenjustiz oder die „Definitionsmacht“[1] einer Polizei, die als strukturkonservative Institution oft auf der Basis traditioneller Vorstellungen von z. B. Frauen oder Migrant*innen agiert. Vielmehr wurden die Kategorien selbst grundlegend hinterfragt und das Verständnis von Macht erweitert. Bereits in den 1960er und 70er Jahren hatte der „labeling approach“[2] in der Kriminologie deutlich gemacht, dass Kriminalität schlicht das ist, was die Gesellschaft als solche versteht. Nun setzte sich die Erkenntnis durch, dass auch „Frau“ oder „Schwarzer“ keine natürlichen Tatsachen sind, sondern gesellschaftlich hervorgebracht werden – wobei die Subjekte nicht nur durch staatliche Ver- und Gebote sowie Ideologie reguliert werden, sondern durch die machtvollen Anrufungen auch hervorgebracht und tagtäglich in die Machtverhältnisse verwickelt sind, wie es Foucault und Autor*innen der Gouvernementalitätsstudien betonten.[3] Kontrolle im Kapitalismus: Eine intersektionale Perspektive weiterlesen