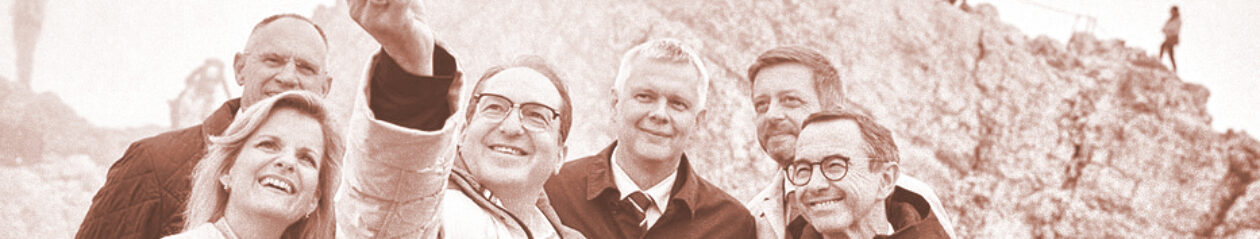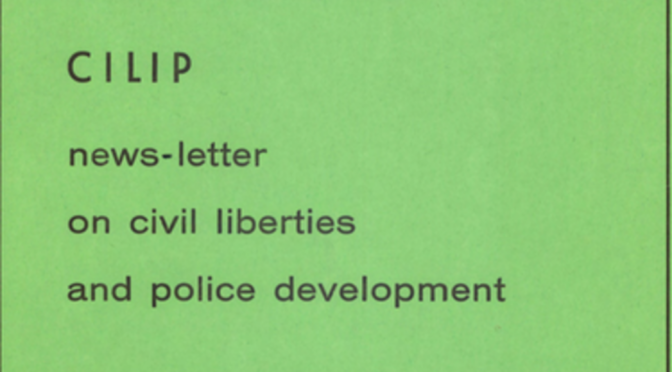Unser Titelbild zeigt die Brückenstraße in Berlin-Treptow. Sie rangiert in den Meldungen von Reach-out, der Berliner Beratungsstelle für Opfer rechtsextremer und rassistischer Gewalt, immer wieder als Tatort. Der letzte Eintrag stammt vom 2. September 2012: „Gegen 3.20 Uhr wird ein 23-jähriger Mann von drei Neonazis, die zu einem Bundestreffen in der Neonazi-Kneipe ‚Zum Henker‘ angereist sind, als ‚Linker‘ erkannt, geschubst, geschlagen und gejagt. Der 23-Jährige rettet sich in einen Imbiss.“ Redaktionsmitteilung weiterlesen
Alle Beiträge von Heiner Busch
Auch die Vorgeschichte im Blick – Der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss
Interview mit Martina Renner
Die Geschichte des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ beginnt nicht erst mit dem Abtauchen des Trios Mundlos, Böhnhardt und Zschäpe 1998. Das Gewaltpotenzial der Neonazi-Szene wurde verharmlost. Der Verfassungsschutz agierte mit seinen V-Leuten „rechts- und regellos“, sagt Martina Renner. Heiner Busch befragte die Landtagsabgeordnete der LINKEN und stellvertretende Vorsitzende des NSU-Untersuchungsausschusses.
Was ist der Auftrag des Untersuchungsausschusses?
Der Untersuchungsausschuss wurde im Januar 2012 auf gemeinsamen Antrag aller Fraktionen im Thüringer Landtag eingesetzt. Er soll mögliches Fehlverhalten der Sicherheits- und Justizbehörden des Landes im Zusammenhang mit Aktivitäten rechtsextremer Strukturen, insbesondere des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ (NSU) und des „Thüringer Heimatschutzes“ (THS), unter die Lupe nehmen. Zum Auftrag des Ausschusses gehört auch die Rolle der zuständigen Ministerien einschließlich ihrer politischen Leitungen sowie der mit den Sicherheitsbehörden zusammenarbeitenden Personen, der so genannten menschlichen Quellen, der V-Leute also. Auch die Vorgeschichte im Blick – Der Thüringer NSU-Untersuchungsausschuss weiterlesen
Unfall NSU? Falsche Interpretationen und übliche Lösungen
von Heiner Busch
Die Bundesregierung und die etablierten Parteien haben sich längst festgelegt: Mangelnde Koordination, fehlender Informationsaustausch und unklare Kompetenzen seien die Gründe für das Versagen der Sicherheitsbehörden angesichts der Morde des „Nationalsozialistischen Untergrunds“ gewesen. Dementsprechend sehen auch ihre Folgerungen aus.
Der „Nationalsozialistische Untergrund“ (NSU) und die Arbeit der „Sicherheitsbehörden“ beschäftigen derzeit mehrere parlamentarische Untersuchungsausschüsse. Jener des Bundestages wurde im Januar 2012 nach dem üblichen Gerangel zwischen Regierung und Opposition eingesetzt. Das Innenministerium Thüringens – jenes Bundeslandes, aus dessen Neonazi-Szene der NSU hervorgegangen ist – beauftragte zunächst ein Dreiergremium unter Leitung des ehemaligen Bundesrichters Gerhard Schäfer mit einem Gutachten,[1] bevor der Landtag ebenfalls Ende Januar einen Untersuchungsausschuss auf die Beine stellte. Die Parlamente Sachsens und Bayerns zogen im März bzw. im Juli nach. Unfall NSU? Falsche Interpretationen und übliche Lösungen weiterlesen
Schengener Visa-Konsultationsverfahren
Wer auf einem Konsulat eines Schengen-Staates ein Visum beantragt, muss nicht nur darlegen, was der Zweck der Reise ist, und nachweisen, dass er oder sie über die nötigen finanziellen Mittel, eine Reisekrankenversicherung u.ä. verfügt. Die jeweilige Auslandsvertretung prüft auch, ob die AntragstellerInnen im Schengener Informationssystem (SIS) ausgeschrieben sind. Während das SIS und seine Rolle bei der Einreiseverweigerung recht häufig in der Diskussion sind, wird dagegen das so genannte Konsultationsverfahren, das auch den Staatsschutz- und Geheimdiensten der Mitgliedstaaten erlaubt, sich in die Visa-Vergabe einzumischen, kaum beachtet. Schengener Visa-Konsultationsverfahren weiterlesen
Neu ausgerichteter Verfassungsschutz? Konsequenzen der Innenminister aus dem NSU-Debakel
von Heiner Busch
Im Falle NSU hat der Verfassungsschutz komplett versagt. An seine Abschaffung mögen die Innenminister jedoch nicht einmal denken. Ein Jahr nach der Aufdeckung des NSU planen sie die Modernisierung und Zentralisierung des Inlandsgeheimdienstes.
Die Konferenz der Innenminister und -senatoren des Bundes und der Länder (IMK) „steht auch weiterhin zu ihrer Aussage, dass der Verfassungsschutz eine Institution des demokratischen Rechtsstaates und maßgebliche Bewertungsinstanz für Extremismus ist.“ So steht es in der Pressemitteilung, die der Innenminister von Mecklenburg-Vorpommern als derzeitiger Vorsitzender der IMK am 7. Dezember 2012 herausließ. Das Gremium hatte sich in den Tagen zuvor nicht nur mit dem NPD-Verbot, sondern auch mit der „zukünftigen Ausrichtung des Verfassungsschutzes“ befasst und eine neue Richtlinie für die Zusammenarbeit zwischen dem Bundesamt und den Landesämtern beschlossen. „Die im Verlauf des letzten Jahres erkannten Defizite in der Zusammenarbeit der Sicherheitsbehörden können damit unterbunden werden.“ Das seltsam anmutende Bekenntnis der Innenminister zu ihrem Inlandsgeheimdienst sollte wohl die seit November 2011 andauernde Debatte um das Versagen des Verfassungsschutzes im Falle NSU, der übrigens in der Presseerklärung nur als „aktuelle Ereignisse“ vorkommt, abschließen. Neu ausgerichteter Verfassungsschutz? Konsequenzen der Innenminister aus dem NSU-Debakel weiterlesen
Trotz allem: gegen das NPD-Verbot. Wer das Parteiverbot bestellt, kauft die fdGO mit ein
von Heiner Busch
Die Innenministerkonferenz hat am 5. Dezember 2012 empfohlen, einen neuen Anlauf für ein NPD-Verbotsverfahren zu nehmen. Ein Akt symbolischer Politik, der dem angeschlagenen Verfassungsschutz, der dafür eine Materialsammlung erstellt hat, mehr Legitimität beschert.
Außen billige, papp-süße Schokolade, innen hohl – das sind die Nikoläuse, die man Kindern in der Nacht zum 6. Dezember in die Stiefel steckt. Das Geschenk, das die Innenministerkonferenz (IMK) auf ihrer Dezembersitzung der bundesdeutschen Öffentlichkeit gemacht hat, ist von ähnlicher Qualität. Das neue NPD-Verbotsverfahren, das der Bundesrat inzwischen beschlossen hat, täuscht einen entschlossenen Kampf gegen den Rechtsextremismus vor, schmeckt aber vor allem nach der alten „freiheitlichen demokratischen Grundordnung“. Weder die Neonazi-Szene noch der bis weit in die Mitte der Gesellschaft und – notabene – in die staatliche Migrationspolitik reichende Rassismus werden dadurch erledigt. Trotz allem: gegen das NPD-Verbot. Wer das Parteiverbot bestellt, kauft die fdGO mit ein weiterlesen
Redaktionsmitteilung
42 Seiten im Format A 4, „gesetzt“ auf einer IBM-Kugelkopf-Schreibmaschine, zusammengeleimt auf einem selbst gezimmerten Layout-Tisch, kopiert und zwischen zwei grüne Pappen geheftet – das war die Nullnummer von „CILIP“, die im März 1978 erschien. Die ästhetischen Ansprüche waren klein, die inhaltlichen dafür umso größer. Das Heft sollte den Mangel an Informationen über Polizei und Geheimdienste mindern, Analysen über deren Entwicklung liefern und so „Munition“ für die im Kampf um Bürgerrechte engagierten Gruppen und Einzelnen bereit stellen.
Die Form des Informationsdienstes hat sich im Laufe der Jahre geändert. Der Anspruch, keine akademische, sondern eine politisch eingreifende Zeitschrift sein zu wollen, blieb. Die Themen, mit denen sich dieses Blatt auseinander setzen musste, tauchten in ständig neuen Varianten auf: die habhafte polizeiliche Gewalt, insbesondere bei Demonstrationen, der feine informationelle Zugriff, der Ausbau der Befugnisse von Polizei und Geheimdiensten, ihre Zusammenarbeit trotz organisatorischer Trennung sowie – in wachsendem Maße – ihre europäische und internationale Aktivität. In diesen Themenbreichen erlauben wir uns in dieser 100. Ausgabe eine Zwischenbilanz. Redaktionsmitteilung weiterlesen
Geheimdienste abschaffen! Eine Replik auf Mark Holzberger und Albrecht Maurer
von Heiner Busch und Norbert Pütter
Ja, die bürgerrechtlichen Forderungen nach Abschaffung der deutschen Geheimdienste sind wirkungslos geblieben. Ja, Polizeien und „geheime Nachrichtendienste“ weisen heute mehr Ähnlichkeiten auf als vor 30 Jahren. Ja, das Trennungsgebot war eine westdeutsche Besonderheit. Aber diese Einsichten ändern nichts an dem Umstand, dass die Abschaffung der Geheimdienste weiterhin das Gebot der Stunde bleiben muss.
Vier Argumente sind für die Bilanz von Mark Holzberger und Albrecht Maurer zentral: 1. Die Abschaffungsforderung sei politisch wirkungslos geblieben. 2. Das Trennungsgebot sei eine deutsche Besonderheit, die weder der Politik der „vernetzten Sicherheit“ in der BRD noch der Realität in Europa gerecht werde. 3. Im bürgerrechtlichen Diskurs werde nicht ausreichend benannt, welche Aufgaben von wem wahrgenommen werden sollten, wenn die Geheimdienste abgeschafft würden. 4. Die neuen Gefahren erforderten geheime Ausforschungen. Wenn die Geheimdienste abgeschafft würden, würden die Polizeien diese Aufgabe wahrnehmen, wodurch die Gefahren erheblich stiegen. Im Folgenden wollen wir kurz diese Argumente aus unserer Sicht kommentieren. Geheimdienste abschaffen! Eine Replik auf Mark Holzberger und Albrecht Maurer weiterlesen
Neue europäische Polizeikooperation – Eine Bestandsaufnahme nach mehr als drei Jahrzehnten
Angesichts neuer internationaler Bedrohungen brauche es mehr Informationsaustausch und eine direktere Zusammenarbeit. Das waren polizeiliche Forderungen der 70er Jahre. Was ist daraus geworden?
1978 erhielt die Redaktion des gerade entstandenen Informationsdienstes CILIP einen Brief des niederländischen Kollegen Cyrille Fijnaut: Ein neues europäisches Polizeigremium sei entstanden, das sich unter dem Namen TREVI treffe. Das Kürzel stehe für „terrorisme, radicalisme, extremisme, violence internationale“ Es sei völlig unklar, was die Herrschaften dort treiben. Und es sei dringend erforderlich, das im Auge zu behalten. In der Tat zeigten sich hier die Anfänge einer neuen Polizeikooperation. Schon neun Jahre später konstatierte Fijnaut, dass sich hier ein „turbulenter“ Wandel vollzogen habe, dessen Schnelligkeit vor allem dem Umstand zu verdanken sei, dass die Terrorismusbekämpfung sein ideologisches Treibmittel war und folglich „die Sicherheit des Staates … in Frage stand oder zu stehen schien.“[1] Die „Turbulenzen“ hörten aber keineswegs auf, als das Thema Terrorismus in den 80er und 90er Jahren in den Hintergrund trat und – bis zum Herbst 2001 – durch neue Bedrohungsbilder der „organisierten Kriminalität“, des internationalen Drogenhandels, der illegalen Einwanderung etc. abgelöst wurde. Neue europäische Polizeikooperation – Eine Bestandsaufnahme nach mehr als drei Jahrzehnten weiterlesen
Redaktionsmitteilung
Als diese Zeitschrift Ende der 70er Jahre gegründet wurde, war ein Teil ihrer Redakteure in der „Arbeitsgemeinschaft Bürger beobachten die Polizei“ in Westberlin engagiert. Der Verein betrieb eine allwöchentliche Beratung für Opfer alltäglicher Polizeiübergriffe und publizierte das, was sie erlebt hatten: willkürliche Kontrollen, Schläge, die immer wiederkehrende Erfahrung, dass Polizeibeamte auf Anzeigen mit Gegenanzeigen reagierten, etc. „Unsere Polizei wird bereits genügend kontrolliert“, lautete damals die Antwort der Polizeiführung und der Polizeigewerkschaften. Der unerhörte Auftritt der Arbeitsgemeinschaft brachte ihren Mitgliedern überdies eine Akte beim Landesamt für Verfassungsschutz ein.
Mehr als drei Jahrzehnte sind vergangen und wir schlagen uns immer noch mit denselben Forderungen herum: Die Kennzeichnung von PolizistInnen konnte erst jüngst in zwei Bundesländern – Berlin und Brandenburg – durchgesetzt werden, ein minimaler Erfolg. Die Einrichtung unabhängiger Beschwerdestellen ist hierzulande weiterhin Zukunftsmusik. Die Hamburger Polizeikommission, der einzige deutsche Versuch in diese Richtung, überlebte nur drei Jahre. Redaktionsmitteilung weiterlesen