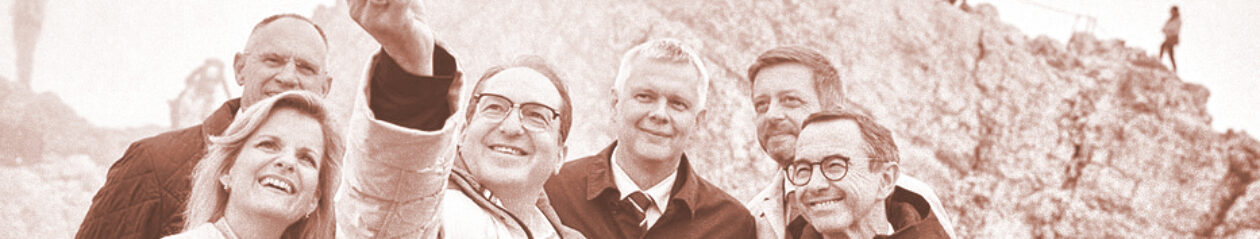Das Europäische Parlament (EP) hat der Kommission am 13. März 2003 eine schallende Ohrfeige erteilt. In einer Entschließung über die “Weitergabe personenbezogener Daten durch Luftfahrtgesellschaften an die Einwanderungsbehörde der Vereinigten Staaten” zeigt sich das EP darüber “enttäuscht”, dass die Kommission ihre Befugnisse als “Hüterin der Verträge und des Gemeinschaftsrechts” nicht wahrgenommen habe, und droht gar mit einer Klage beim EU-Gerichtshof in Luxemburg.[1] Die Weitergabe von Flugdaten an die USA, so rechnet das EP vor, beträfe jährlich 10 bis 11 Millionen Passagiere der transatlantischen Flüge. Weitergabe von Flugdaten an die USA weiterlesen
Alle Beiträge von Heiner Busch
Terrorismusbekämpfung in der EU – Ein Jahr nach dem 11. September
von Mark Holzberger und Heiner Busch
Die Terrorismusbekämpfung hat der Innen- und Justizpolitik der EU neuen Treibstoff zugeführt. Wohin die Reise gehen soll, ist einem 64 Punkte umfassenden „Fahrplan“ zu entnehmen, der seit Oktober 2001 ständig aktualisiert wird.[1]
Der Entwurf für eine gemeinsame Terrorismus-Definition hat offenbar bereits vor den Anschlägen vom 11. September 2001 in einer Schublade der EU-Kommission gelegen, denn präsentiert wurde er bereits acht Tage danach. Am 22. Juni 2002 trat der entsprechende Rahmenbeschluss in Kraft.[2] Die Mitgliedstaaten haben ihn nun in ihr Strafrecht zu übernehmen; d.h. unter anderem, dass sie entweder einen Straftatbestand der „terroristischen Vereinigung“ neu einführen oder – wie Deutschland und fünf weitere EU-Staaten – bereits bestehende Regelungen anpassen müssen. Terrorismusbekämpfung in der EU – Ein Jahr nach dem 11. September weiterlesen
Vertiefung, Erweiterung, Verfassung … Wo steht die Innen- und Justizpolitik der EU?
von Heiner Busch
An den Zielen der Innen- und Justizpolitik der EU soll sich nichts Grundsätzliches ändern, weder durch die Erweiterung noch durch die Verfassung, die der Konvent ausarbeitet.
Seit dem Gipfeltreffen in Kopenhagen am 13. und 14. Dezember 2002 ist es definitiv: Mitte 2004 wird die Europäische Union um zehn Staaten gewachsen sein und neben Malta und Zypern auch große Teile Osteuropas umfassen. Rumänien und Bulgarien stehen in der Beitrittsschlange, und die Türkei darf sich bald ebenfalls anstellen. Nachdem das Thema Erweiterung geklärt sei, so die Staats- und Regierungschefs, komme es nun auf die Vertiefung an. Auch hier wird das Jahr 2004 Entscheidungen bringen: Die EU muss sich bis dahin festlegen, ob und wie sie die Innen- und Justizpolitik weiter „vergemeinschaftet“. Der Konvent strickt an einer Verfassung für das eigenartige Staatsgebilde EU. Vertiefung, Erweiterung, Verfassung … Wo steht die Innen- und Justizpolitik der EU? weiterlesen
Telekommunikation: Speicherung von Verbindungsdaten
Zwei Jahre lang stritten sich der Rat und das Europäische Parlament (EP) um die Richtlinie „über die Verarbeitung personenbezogener Daten und den Schutz der Privatsphäre“. Noch bei der ersten Lesung im November 2001 hatte das EP daran festgehalten, dass Anbieterfirmen die bei der Telekommunikation anfallenden Verbindungsdaten nur zur Rechnungslegung aufbewahren dürfen und danach zu löschen haben. Eine Speicherung zu Zwecken der Strafverfolgung oder „nationalen Sicherheit“ und der Zugang von Polizei oder Geheimdiensten sollte ausgeschlossen bleiben. Telekommunikation: Speicherung von Verbindungsdaten weiterlesen
Biometrische Identifizierungssysteme – Auf dem Weg zur automatischen Überwachung
von Martina Kant und Heiner Busch
In Ausweispapiere und Visa sollen biometrische Daten eingetragen werden. So sieht es das Anfang des Jahres in Kraft getretene „Terrorismusbekämpfungsgesetz“ vor. Verfahren zur automatisierten Wiedererkennung körperlicher oder verhaltensspezifischer Merkmale haben nach dem 11. September verstärkt Konjunktur, obwohl keines der Systeme bisher technisch ausgereift ist.
Personen anhand unveränderlicher körperlicher Merkmale zu identifizieren, gehört seit langem zum Geschäft der Polizeibehörden. Die Vermessung von Körper und Kopf, die Anthropometrie bzw. Bertillonage (benannt nach ihrem Erfinder, dem französischen Arzt Auguste Bertillon), bildete die Grundlage der ersten Messkartenzentralen, die diverse europäische Polizeien seit den 70er Jahren des 19. Jahrhunderts aufbauten. Nur dreißig Jahre später begann die Daktyloskopie den Erkennungsdienst zu revolutionieren. Bereits 1925 verfügten alle Polizeien Europas über Fingerabdruckregister. Diktaturen leisteten sich den „Luxus“, nicht nur Verdächtige und Fremde, sondern gleich die gesamte Bevölkerung zu erfassen: Seit seiner Einführung unter Franco im Jahre 1940 enthält der spanische Personalausweis einen Fingerabdruck.
Im Unterschied zu diesen traditionellen Techniken der Identifizierung geht es bei biometrischen Verfahren um eine automatische Wiedererkennung. Die Identifizierung besorgt nicht mehr ein menschlicher Kontrolleur, der z.B. das Gesicht einer vor ihm stehenden Person mit dem Bild auf dem Ausweis oder dem Fahndungsfoto vergleicht, sondern ein Computer. Biometrische Identifizierungssysteme – Auf dem Weg zur automatischen Überwachung weiterlesen
Per Gesetz gegen ein Grundrecht – Eine kurze Geschichte des Demonstrationsrechts
von Heiner Busch
Das Versammlungsgesetz, autoritäre Traditionsbestände im Strafrecht und flexible Regelungen des „modernen“ Polizeirechts bewirkten seit Gründung der Bundesrepublik, dass die Versammlungsfreiheit nicht grenzenlos wurde.
Mutig waren sie nicht, die Väter und wenigen Mütter des Grundgesetzes (GG). Sie verankerten zwar in Art. 8 Abs. 1 GG das Recht aller Deutschen, „sich ohne Anmeldung oder Erlaubnis friedlich und ohne Waffen zu versammeln“, sorgten jedoch in Abs. 2 dafür, dass das Grundrecht „für Versammlungen unter freiem Himmel … durch Gesetz oder aufgrund eines Gesetzes beschränkt werden“ kann. Die Formulierung der Versammlungsfreiheit ist halbgar, diktiert von der Angst vor dem Volk – ein „typisches Kompromissprodukt der deutschen Verfassungsgeschichte“, in der einer Opposition außerhalb der verstaatlichten Formen immer polizeiliche Grenzen gesetzt wurden. „Der Gesetzesvorbehalt in Art. 8 Abs. 2 GG, der seine Schranke erst in der Wesensgehaltsgarantie des Art. 19 Abs. 2 GG findet, war das gesetzestechnische Einfallstor, mit dem an staatsautoritäre Traditionsbestände reibungslos angeknüpft werden konnte.“[1] Per Gesetz gegen ein Grundrecht – Eine kurze Geschichte des Demonstrationsrechts weiterlesen
Vor neuen Gipfeln – Über die Schwierigkeiten internationaler Demonstrationen
von Heiner Busch
EU- oder G8-Gipfel, Tagungen der Welthandelsorganisation oder des (privaten) Davoser World Economic Forums – wo die Mächtigen der Welt zusammenkommen, wird die Wahrnehmung demokratischer Rechte zum Risiko.
Rund ein Jahr ist es her, dass ein 20-jähriger Carabiniere bei den Protesten gegen den G8-Gipfel in Genua einen 23-jährigen Demonstranten erschoss. Der Tod des Carlo Giuliani, die Blutspuren in der „durchsuchten“ Scuola Diaz und die Misshandlung von Inhaftierten, die „teilweise über 15 Stunden an der Wand stehen oder 24 Stunden ohne Wasser und Nahrung“ verbringen mussten, haben Ende Juli letzten Jahres die Öffentlichkeit erschüttert.[1] Für kurze Zeit wurde die stereotype Warnung vor dem „Schwarzen Block“ von der Kritik an der Eskalationsstrategie der Regierung Berlusconi und ihrer Polizei überlagert. Die systematische Unterdrückung der Proteste gegen den G8-Gipfel in Genua waren jedoch kein singuläres Ereignis. Bereits wenige Wochen zuvor, beim Treffen des Europäischen Rates in Göteborg, hatten Polizisten gegen Demonstrierende von der Schusswaffe Gebrauch gemacht.
Nach den Ereignissen von Genua sah sich selbst das Europäische Parlament (EP) gezwungen, die EU-Regierungen auf die Versammlungs- und Vereinigungsfreiheit, den Datenschutz und die Bewegungsfreiheit hinzuweisen. Im sog. Watson-Bericht kritisiert das EP den „unverhältnismäßigen Einsatz von Gewalt“ und propagiert eine Deeskalationsstrategie sowie den „Dialog mit den Globalisierungsgegnern“. Mit seinen Forderungen, „gewalttätige Gruppen (den so genannten ‚Black Block‘) oder kriminelle Organisationen“ effizient zu bekämpfen sowie EU-weit zu definieren, wer bzw. was „gefährliche Personen und Verhaltensweisen“ sein sollen, rennt das EP beim Rat der Innen- und Justizminister jedoch offene Türen ein.[2] Vor neuen Gipfeln – Über die Schwierigkeiten internationaler Demonstrationen weiterlesen
Rasterfahndung – Gegenwärtige Gefahr für die Grundrechte
von Heiner Busch
Sich widersprechende Gerichtsurteile, eine von Land zu Land unterschiedliche Praxis, massenhaft Daten, aber keine Ergebnisse – das ist die Bilanz nach rund einem halben Jahr der Rasterfahndungen.
Ausländischen Studenten ist es zu verdanken, dass eine der gefährlichsten Ermittlungsmethoden der deutschen Polizei rechtlich hinterfragt wird: Aufgrund ihrer Klagen entschieden die Landgerichte Berlin und Wiesbaden am 15. Januar bzw. 6. Februar 2002, dass eine „gegenwärtige Gefahr“ nicht bestehe und die Ende September letzten Jahres begonnenen Rasterfahndungen daher unzulässig seien.[1] Die beiden Gerichte stützten ihre Beschlüsse pikanterweise auf Erklärungen der Bundesregierung, „wonach keine Anzeichen dafür ersichtlich sind, dass die Verübung terroristischer Anschläge in der Bundesrepublik Deutschland bevorsteht“. Dies habe sich auch nach der Entscheidung des Bundestages, deutsche Soldaten nach Afghanistan zu entsenden, nicht geändert. Sogenannte Schläfer – so heißt es in dem Wiesbadener Beschluss – seien in der BRD zwar entdeckt worden, „fortgeschrittene Planungen konkreter Anschläge konnten ihnen jedoch nicht nachgewiesen werden.“ Rasterfahndung – Gegenwärtige Gefahr für die Grundrechte weiterlesen
Überwachung auf industriellem Niveau – Echelon und das Versagen des Europäischen Parlaments
von Heiner Busch
Echelon ist ein globales Abhörsystem, das vom US-Geheimdienst NSA dominiert wird. Von Juli 2000 bis Juli 2001 bemühte sich ein „nicht-ständiger Ausschuss“ des Europäischen Parlaments (EP) um Aufklärung über dieses System und seine Wirkungen. Herausgekommen ist ein zwar durchaus lesenswerter, aber verheerend unpolitischer Bericht.[1]
Kann es ein weltumspannendes Überwachungssystem überhaupt geben? Wer könnte es mit welchen Mitteln betreiben? Welche Art und wessen Kommunikation wäre davon betroffen? Die Fragen, die sich der EP-Ausschuss stellte, bewegten sich nach wie vor im Konjunktiv. Überwachung auf industriellem Niveau – Echelon und das Versagen des Europäischen Parlaments weiterlesen
Planungen für das SIS II
Mit dem Wind des 11. Septembers im Rücken hat die SIS-Arbeitsgruppe des Rates die Planungen für das Schengener Informationssystem der zweiten Generation erheblich vorangetrieben. Das System wird technisch von der EU-Kommission entwickelt und über den Gemeinschaftshaushalt finanziert. Der Rat nahm hierzu am 6. Dezember eine Verordnung (1. Säule) und einen Beschluss (3. Säule) an.[1] Planungen für das SIS II weiterlesen