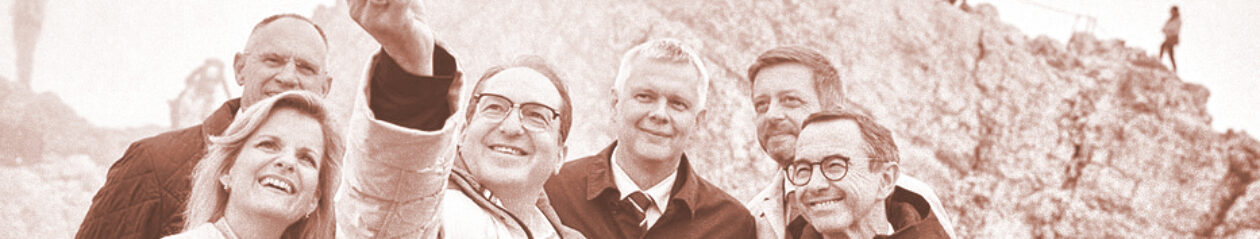Um einen Export heimischer Methoden auf die Ebene der EU bemüht sich auch die BRD.[1] Bereits im Oktober forderte sie den Aufbau eines EU-weiten und jeweils nationaler Ausländerzentralregister. Über eine solche Datenbank verfügt außer Deutschland bisher nur ein EU-Staat (Luxemburg). Weitere Vorschläge wurden in Deutschland in dem am 1. Januar in Kraft getretenen „Terrorismusbekämpfungsgesetz“ verankert: Verwendung von Eurodac-Daten (Fingerabdrücke von Flüchtlingen) für polizeiliche Zwecke, Visa-Entscheidungs-Dateien mit polizeilichem und geheimdienstlichem Zugriff, neue Methoden der „Identitätssicherung“. EU-weite Rasterfahndung weiterlesen
Alle Beiträge von Heiner Busch
Terrorismus-Definition und die Folgen
Die am 6. Februar auch vom Europäischen Parlament gebilligte Terrorismus-Definition der EU zwingt die Mitgliedstaaten zur Einführung eines Tatbestandes der „terroristischen Vereinigung“ und erlaubt es, typische Handlungsformen militanten Protests (u.a. Haus- und Platzbesetzungen) als „terroristisch“ zu kriminalisieren.[1] Bürgerrechtliche Kritik an diesem Rahmenbeschluss hatte der Rat durch hastig eingebaute Bekundungen abzufedern versucht: „Grundrechte wie die Versammlungs-, Vereinigungs- oder Meinungsfreiheit“ würden nicht geschmälert. Terrorismus-Definition und die Folgen weiterlesen
Nichts zu verbergen? Datenschutz, Sicherheitsgesetze, Rasterfahndung
von Heiner Busch
Die Rasterfahndung – jetzt zur Suche nach „Schläfern“ praktiziert – ist eine jener polizeilichen Befugnisse, die die informationelle Selbstbestimmung der Betroffenen durchlöchern. Woher nimmt der Bundesinnenminister die Idee, wir hätten „vielleicht … im Datenschutz etwas übertrieben“?[1]
Das Zweckbindungsgebot ist ein zentraler Grundsatz des Datenschutzes. Es besagt, dass Daten nur zu dem Zweck bearbeitet werden dürfen, für den sie auch erhoben wurden. Die Rasterfahndung steht diesem Prinzip diametral entgegen. Die Methode, der sich die deutsche Polizei seit den 70er Jahren bedient, besteht darin, Datenbestände anderer Verwaltungen oder privater Stellen nach einem bestimmten Muster miteinander abzugleichen. Im Falle der Anfang Oktober gestarteten Rasterfahndungen bedeutet das: Daten von Personen aus Ländern des Nahen Ostens, die bei Melde- und Ausländerbehörden, Hochschulen, Energie- und „Entsorgungs“-Unternehmen, bei Nah- und Fernverkehrsunternehmen oder „Kommunikationsdienstleistern“, bei Reinigungs- und Cateringfirmen oder Sicherheitsdiensten, bei öffentlichen und privaten Stellen, die sich mit Atomenergie sowie chemischen und biologischen Gefahrenstoffen befassen, bei Flughafengesellschaften, Flugschulen und Luftfahrtfirmen gespeichert sind, werden zweckentfremdet.[2] Sie dienen nicht mehr der Verwaltung von Hochschulangelegenheiten oder der korrekten Abrechnung der zustehenden Löhne, sondern einem polizeilichen Zweck, für den sie nicht erhoben wurden. Die Betroffenen haben die Kontrolle über ihre Daten verloren. Nichts zu verbergen? Datenschutz, Sicherheitsgesetze, Rasterfahndung weiterlesen
Zusammenarbeit mit den USA
Im Zusammenhang mit der Strafverfolgung und der Terrorismusbekämpfung solle die EU ihre Datenschutzbestimmungen überdenken. Das ist eine von über 40 Forderungen, die US-Präsident George W. Bush am 16. Oktober in einem Brief an den Präsidenten der EU-Kommission erhoben hat. Neben dem weiteren Abbau des Datenschutzes will Bush u.a. eine schnelle und informelle Kooperation von Polizei- und Justizbehörden beider Seiten – inklusive Europol und Eurojust. Dringende Rechtshilfegesuche sollen „wenn irgend möglich“ mündlich gestellt werden können, die schriftliche Fassung könne nachgeliefert werden. Die USA möchten beim EU-Haftbefehl einbezogen werden. Zusammenarbeit mit den USA weiterlesen
Ausbau des Schengener Informationssystems (SIS)
Der Input von Daten ins SIS sei zu verbessern. Diese Forderung findet sich unter Punkt 45 des Anti-Terror-Fahrplans der EU.[1] Was damit gemeint ist, ergibt sich aus einem Vorschlag der belgischen Präsidentschaft vom 15. Oktober dieses Jahres, der von der SIS-Arbeitsgruppe bereits zustimmend zur Kenntnis genommen wurde.[2]
Zum einen soll der technische Umbau des SIS zu einem „SIS der zweiten Generation“ dazu genutzt werden, das System um eine Visa-Datei zu ergänzen. Ausbau des Schengener Informationssystems (SIS) weiterlesen
Nach Göteborg und Genua – Weder Reisefreiheit noch Demonstrationsrecht in der EU?
von Olaf Griebenow und Heiner Busch
Übermittlung ungesicherter Daten über „Risikogruppen“, strenge Kontrollen im Inland und an den Grenzen, Ein- und Ausreiseverbote, vorbeugende Festnahmen – derartige Maßnahmen schienen im grenzenlosen Europa bisher nur für Fußball-Hooligans vorgesehen. Nun werden sie auch gegen internationale Demonstrationen genutzt.
Die Befürchtungen haben sich bestätigt. Bei zwei internationalen Demonstrationen – gegen den EU-Gipfel in Göteborg und gegen den G8-Gipfel in Genua – hat die Polizei gezielt auf Protestierende geschossen. In Genua wurde ein Demonstrant getötet. Hunderte wurden zum Teil schwer verletzt – bei den harten Polizeieinsätzen während der Demonstrationen selbst, aber auch bei der Räumung jener Schule, in der das Genua Social Forum untergebracht war. Die Eskalationsstrategie der italienischen Regierung, der die EU-Partner im Vorfeld heftig applaudiert haben, die krampfhafte Verteidigung demonstrationsfreier Zonen gegen die Grundrechte von Hunderttausenden hat ihre Wirkung getan. Nach Göteborg und Genua – Weder Reisefreiheit noch Demonstrationsrecht in der EU? weiterlesen
Offene Grenzen – aber nur für die Polizei – Verrechtlichung grenzüberschreitender Polizei-Aktionen
von Heiner Busch
Sechs Jahre nachdem das Schengener Durchführungsübereinkommen (SDÜ) für die ersten sieben Staaten in Kraft getreten ist, verhandeln die EU-Gremien über Nachbesserungen. Mehr als bisher schon sollen die Polizeibehörden über die Staatsgrenzen hinweg agieren dürfen. Bundesinnenministerium (BMI) und Innenministerkonferenz (IMK) orientieren sich dabei am deutsch-schweizerischen Polizeivertrag.
Ministerialdirigent a. D. Horst Eisel ist des Lobes voll. Von 1997 bis 1999 führte er die deutsche Delegation, die mit dem Eidgenössischen Justiz- und Polizeidepartement, dem schweizerischen Justizministerium, ein Abkommen über polizeiliche Zusammenarbeit aushandelte. Dieser deutsch-schweizerische Polizeivertrag wurde am 27. April 1999 in Bern unterzeichnet. „Man sprach“, so Eisel, „von einem Signal für eine fortschrittliche grenzüberschreitende polizeiliche und justizielle Partnerschaft, von einem Modell für Europa.“[1] Die beiden Kammern der schweizerischen Bundesversammlung haben dem Abkommen bereits zugestimmt, in Deutschland befindet es sich mitten im Ratifizierungsprozess: Der Innenausschuss hat seinen Segen gegeben, nach der Sommerpause ist das Plenum des Bundestages an der Reihe. Offene Grenzen – aber nur für die Polizei – Verrechtlichung grenzüberschreitender Polizei-Aktionen weiterlesen
Europol und Eurojust – Die politische Debatte leidet unter Rechtsillusionen
von Ben Hayes und Heiner Busch
Seit dem Amsterdamer Vertrag steht fest: Europol soll „operative“ Befugnisse erhalten. Die rechtliche und politische Debatte läuft der tatsächlichen Entwicklung wieder einmal hinterher, denn faktisch ist das Amt auch als Informationspolizei längst „operativ“ tätig. Ob durch den Aufbau von Eurojust ein justizielles Gegengewicht zur polizeilichen und politischen Macht von Europol geschaffen werden kann, ist sehr zu bezweifeln.
Ende vergangenen Jahres arbeiteten 245 Personen bei Europol. 47 von ihnen waren VerbindungsbeamtInnen der Mitgliedstaaten, 156 Europol-BeamtInnen im engeren Sinne, darunter wiederum rund 30 Informations- und KommunikationstechnikerInnen, 40 KriminalanalystInnen und 36 Personen in der kriminalpolizeilichen Auswertung.[1] Heute, zehn Jahre nachdem der Europäische Rat in Luxemburg dem Drängen des deutschen Bundeskanzlers nachgegeben hatte und wegen der angeblich so dramatischen Entwicklung des Drogenhandels den politischen Startschuss für den Aufbau des Amtes gab, ist Europol eine feste Größe in der polizeilichen und innenpolitischen Landschaft der EU. Die 1995 unterzeichnete Konvention ist im Oktober 1998 in Kraft getreten; im Juli 1999 nahm Europol mit allen notwendigen Zusatzprotokollen und Durchführungsbestimmungen den „Vollbetrieb“ auf. Das Provisorium mit Namen Europol-Drogeneinheit (EDU) war damit definitiv abgeschlossen. Provisorisch war daran ohnehin nur der rechtliche Status, die ministerielle Vereinbarung aus dem Jahre 1993, gewesen. Tatsächlich waren mit dem Arbeitsantritt der EDU im Januar 1994 vollendete Tatsachen geschaffen, die nur noch ihrer rechtlichen Form und ihres weiteren Ausbaus bedurften. Europol und Eurojust – Die politische Debatte leidet unter Rechtsillusionen weiterlesen
Ohne Bremse und Rückwärtsgang – Die polizeipolitische Maschinerie der EU nach Amsterdam
von Heiner Busch
Die innen- und justizpolitische Zusammenarbeit der EU-Staaten ist heute eine gut geölte politische Maschine, die fast gänzlich ohne den Treibstoff demokratischer Kontrolle und Öffentlichkeit auskommt. Das Tempo, mit der diese Maschine Vorschläge zum Ausbau der „inneren Sicherheit“ in der EU produziert, hat seit dem Amsterdamer Vertrag erheblich zugenommen.
„Anzeiger der Fortschritte bei der Schaffung eines Raumes der Sicherheit, der Freiheit und des Rechts in der Europäischen Union“ – diesen Titel trägt ein Dokument, das die EU-Kommission halbjährlich aktualisiert.[1] Den Auftrag dazu erteilte ihr der Europäische Rat, die Staats- und Regierungschefs der EU, bei ihrer Tagung im finnischen Tampere im Oktober 1999. In der dritten Fassung vom Mai 2001 ist dieses Dokument 41 Seiten lang. Es enthält nur wenig Lauftext, dafür um so mehr Tabellen, in denen sämtliche Bereiche der Innen- und Justizpolitik durchgegangen werden: Ziel, erforderliche Maßnahme, Zuständigkeit, Zeitplan, Stand, lauten die Spaltenüberschriften. Hier werden die Hausaufgaben der zuständigen EU-Gremien aufgelistet, damit auch ja nichts in Vergessenheit gerät. Ohne Bremse und Rückwärtsgang – Die polizeipolitische Maschinerie der EU nach Amsterdam weiterlesen
Und mach‘ nur einen Plan … Die neueste Reorganisation des schweizerischen Bundesamtes für Polizei
von Heiner Busch
Seit einem Jahrzehnt jagen sich die Reorganisationspläne bei der schweizerischen Polizei. Auf Dauer besteht die Gefahr, dass dabei vom Föderalismus nicht viel übrig bleibt.
Die Beschreibung der Abteilungen und Sektionen auf der Homepage des Bundesamtes für Polizei (BAP) gleicht derzeit noch einem Emmentaler Käse. Neben gummiartigen Aussagen zu einigen der neuen Organisationsgliederungen – z.B. zum „Dienst für Analyse und Prävention“ (DAP) – finden sich diverse Löcher. „Text in Überarbeitung“ heißt es noch Ende März dort, wo eigentlich das Kernstück der zu Jahresbeginn in Kraft getretenen neuen Organisation – die neue Hauptabteilung Bundeskriminalpolizei (BKP) – erläutert werden sollte. Mit mehr als 70 Untereinheiten allein auf der Ebene der den Abteilungen nachgeordneten Sektionen und Dienste erzeugt auch das bunte Organigramm eher Verwirrung als Klarheit.[1] Und mach‘ nur einen Plan … Die neueste Reorganisation des schweizerischen Bundesamtes für Polizei weiterlesen